Preisbestimmung
Methoden der Preisbestimmung sind Rahmenwerke die eine Orientierung liefern zur Definition von Preisen.
Einflussfaktoren der Preisentscheidung
- unmittelbare Faktoren, die sich auf den Preis auswirken:
a. Kosten
b. Wettbewerb (Preise der Wettbewerber)
Nachfrage (wie viel ist der Kunde bereits, maximal zu bezahlen) – Details: siehe Preisdifferenzierung) - mittelbare Faktoren, die sich auf den Preis auswirken:
a. Marketingmix
Produktpolitik (z.B. innovatives Produkt),
Kommunikationspolitik, Vertriebspolitik – Details: siehe https://brain365.de/strategisches-marketing/
b. Marketingstrategie (wie möchte ich mich insgesamt positionieren – z.B. hochpreisig, mittelpreisig, niedrigpreisige Produktangebote) –
c. Rechtliche Rahmenbedingungen (z.B. rechtliche Rahmenbedingungen)
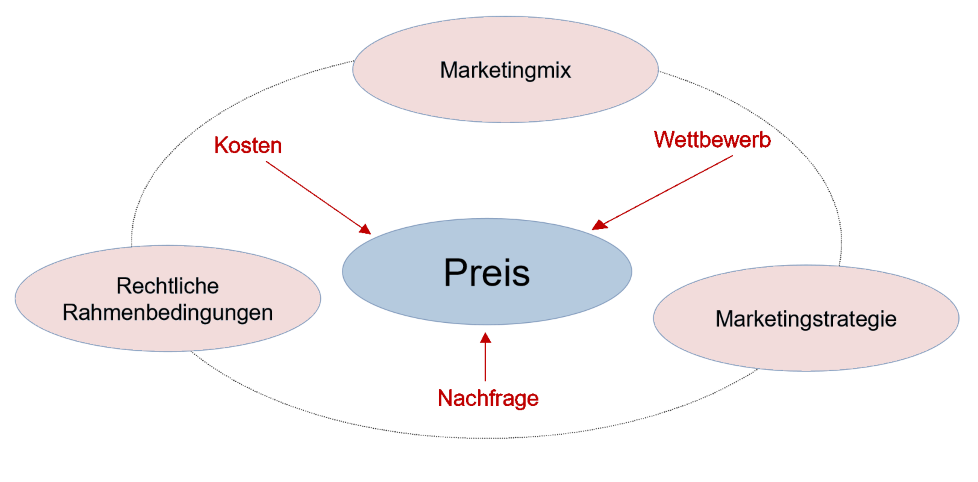
Preisdifferenzierung
Preisdifferenzierung liegt vor,
- wenn ein Anbieter
- identische oder
- geringfügig unterschiedliche Produkte
- verschiedenen Segmenten
- zu unterschiedlichen Preisen anbietet.
Ziel hierbei ist:
- zusätzliche Gewinne generieren durch
- Abschöpfen
- unterschiedlicher Preisbereitschaften.
- unterschiedlicher Preisbereitschaften.
Nutzen der Preisdifferenzierung
- für das anbietende Unternehmen
- Kundenbindung
- Neukundengewinnung
- Umsatzsteigerung bei Abschöpfung der Preisbereitschaft
- Gewinnsteigerung bei Abschöpfung der Preisbereitschaft
- Auslastung
- für den Kunden
- Nutzensteigerung durch kundenindividuelle Preise
Typen und Implementierungsformen der Preisdifferenzierung (nach Pigou)
- Grad: Individuelle Preisdifferenzierung
Zielstellung: Maximalpreis je Kunde individuell erzielen- Preisverhandlungen
- z.B. Preisfestlegung im B2B-Bereich
- Auktionen
- z.B. Ebay-Plattform
- Personalized dynamic Pricing
- Individualisierte Preise auf Grundlage von gesammelten Browserdaten
- Individualisierte Preise auf Grundlage von gesammelten Browserdaten
- Preisverhandlungen
- Grad: Preisdifferenzierung durch Selbstselektion
Segmentzusammenfassung der Kunden, wobei die Kunden selbst wählen, zu welchem Segment sie gehören.- Leistungsbezogene Preisdifferenzierung
Anbieter ändert leistungsbezogene Produktmerkmale, ohne dass die Unterschiede zum Ausgangsprodukt zu groß werden- z.B. Bahntickets der 1. oder 2. Klasse
Basis- oder Premiumsoftware, unterschiedliche Mietklassen
- z.B. Bahntickets der 1. oder 2. Klasse
- Mengenbezogene (mengenmäßige) Preisdifferenzierung
durchschnittlicher Preis pro Einheit variiert in Abhängigkeit der abgenommenen Menge (z.B. Firmenkontingente, Pauschalpreise für Wochenmiete)- z.B. Mengenrabatte
zweiteiliger Tarif
Pauschalpreise
Bonusprogramme
- z.B. Mengenrabatte
- Multi-Channel-Preisdifferenzierung
- z.B. Unterschiedliche Preise in verschiedenen Vertriebskanälen (siehe Vertriebspolitik – Tiefe von Vertriebskanälen)
- Zeitliche Preisdifferenzierung / Dynamic Pricing mit Zeitparameter
abhängig vom Kaufzeitpunkt werden unterschiedliche Preise gesetzt- z.B. Wochenendtarif
Benzinpreise in Tankstellen
Frühbucherrabatte
Volatile Preise im Online-Handel
- z.B. Wochenendtarif
- Leistungsbezogene Preisdifferenzierung
- Grad: Preisdifferenzierung anhand von Kundenkriterien
Segmentzusammenfassung der Kunden, wobei die Segmentierung durch das anbietende Unternehmen erfolgt und der Kunde hat keinen Einfluss
Zielstellung: kundenkriterienbezogene Abschöpfung von Preisbereitschaften
- Räumliche Preisdifferenzierung , wenn diese vom Wohnort/Standort des Kunden abhängt
Orientierung an geografischen Teilmärkten in Form von Ländern, Regionen, Städten
(z.B. Preise für Autos unterscheiden sich in Ländern) - Personenbezogene (personelle) Preisdifferenzierung
spezifische Merkmale der Kunden werden als Abgrenzungskriterien herangezogen
z.B. besondere Preise für Studenten, Studenten-Rabatt, kostenlose Kontoführung für Studierende - Mehrpersonen-Preisbildung
z.B. Verkehrsverbund Großraum Nürnberg: Kinder fahren kostenlos mit - Preisbündelung
liegt vor, wenn ein Anbieter mehrere separate Produkt zu einem Bündel zusammenfasst und dieses zu einem Bündelpreis verkauft (z.B. Mietwagen und Anhänger)
- Räumliche Preisdifferenzierung , wenn diese vom Wohnort/Standort des Kunden abhängt
